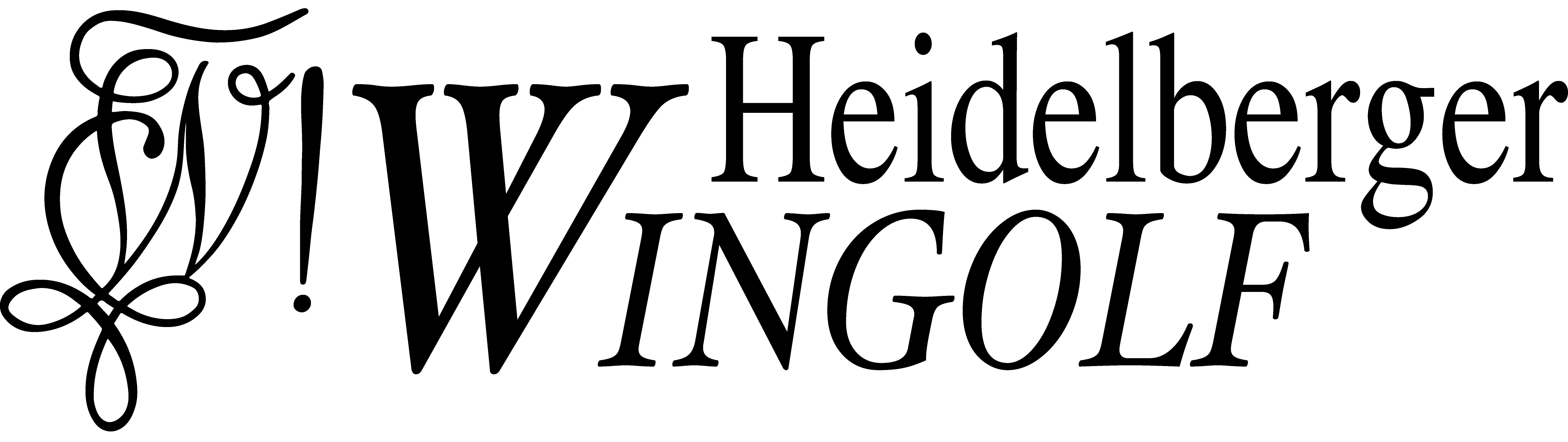Geschichte des Heidelberger Wingolfs
Der Heidelberger Wingolf ist die älteste nichtschlagende Verbindung in Heidelberg. Wie kam es in zur Gründung dieser Studentenverbindung?
Vorgeschichte
Der damalige Dekan und Pfarrer der Peterskirche in Heidelberg, Johann Phillip Sabel, richtete 1844 in seinem Pfarrhaus ein Bibelkränzchen für Theologiestudenten, Vikare und theologisch interessierte Laien ein, das „Sabelsche Kränzchen“. Damit war der Grundstein für die Gründung des Heidelberger Wingolfs gelegt.
Der Heidelberger Wingolf von 1851 bis 1869
Am Abend des 17. Juni 1851 trafen sich 15 Mitglieder des Sabelschen Kränzchens im Gasthaus „Zum Rosenbusch“. Sie beschlossen eine Grundordnung aus fünf Sätzen, die sie alle unterzeichneten. Der erste Satz lautete: „Der Wingolf ist eine christliche Studentenverbindung“. Damit war der Heidelberger Wingolf als christliche Korporation konstituiert. Die Farben des Heidelberger Wingolfs waren damals Schwarz-Weiß-Gold.Nachdem der Heidelberger Wingolf den gesamten Mannheimer Abiturientenjahrgang des Jahres 1852, den die Heidelberger Corps Suevia und Saxo-Borussia schon unter sich aufgeteilt hatten, für sich hatte gewinnen können, brach das Corps Suevia einen Streit vom Zaun, in dessen Verlauf sogar die Kneipe des Wingolfs gestürmt wurde. Die Universität, die zunächst Pedelle bereitstellte, sah sich außer Stand, den Wingolf zu schützen, man schlug der Verbindung vor, die Farben abzulegen. Als der Wingolf dies ablehnte, wurde er kurzerhand verboten.Die Wingolfer gründeten daraufhin einen „Christlichen Studentenverein“ ohne Namen oder Farben. Es wurden weiterhin Kneipen gefeiert und schwarz-weiß-goldene Gegenstände getauscht. Bei einer solchen Kneipe 1855 wurde die Gesellschaft in vollen Farben erwischt, worauf alle Teilnehmer der Kneipe für zwei Tage in den Karzer wanderten.Nach einigen Unruhen wurden 1856 auch die Corps verboten, im Wintersemester 1856/57 mußten alle Verbindungen erneut ihre Satzungen einreichen und die Genehmigung beantragen, Farben zu tragen. 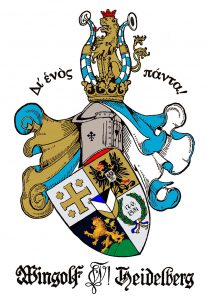 Der christliche Studentenverein beantragte daraufhin die Zulassung als „Arminia“ mit den Farben Blau-Weiß-Gold, dies wurde unter der Auflage genehmigt, daß die Arminia nicht dem Gesamtwingolf, dem Vorläufer des Wingolfbundes, beitreten dürfe. Die Arminia überdauerte aber nur bis zum 31. Oktober 1868, verstärkte Konkurrenz und der Mangel an Nachwuchs waren zuviel – man beschloß die Vertagung.
Der christliche Studentenverein beantragte daraufhin die Zulassung als „Arminia“ mit den Farben Blau-Weiß-Gold, dies wurde unter der Auflage genehmigt, daß die Arminia nicht dem Gesamtwingolf, dem Vorläufer des Wingolfbundes, beitreten dürfe. Die Arminia überdauerte aber nur bis zum 31. Oktober 1868, verstärkte Konkurrenz und der Mangel an Nachwuchs waren zuviel – man beschloß die Vertagung.
Der Wingolf von 1881 bis 1914
Der Heidelberger Wingolf wurde erst am 11. November 1882, zunächst unter dem Namen „Studentischer Verein Fraternitas“, wiedergegründet. Als sich zeigte, daß die Universität gegen den Namen Wingolf nichts mehr einzuwenden hatte, nahm man am 13. November 1882 den Namen „Wingolf“ an, behielt aber die Farben der Arminia, Blau-Weiß-Gold bei.Im Jahr 1889 konnte sich der Wingolf einen lange gehegten Wunschtraum erfüllen – in der Werrgasse 4 kaufte die Verbindung ein Grundstück und baute ein eigenes Haus, das am 26. November 1889 eingeweiht wurde, und in dem der Heidelberger Wingolf noch heute beheimatet ist. Im selben Jahr übernahm der Heidelberger Wingolf zum ersten Mal den Vorsitz im Wingolfsbund.In der Zeit bis 1912 versuchte die Altherrenschaft, die Erweiterung des Wingolfhauses beim Bauamt der Stadt Heidelberg durchzusetzen – dieses lehnte jedoch Antrag um Antrag ab. Einmal paßte der Baustil nicht, ein andermal war die zu erwartende Lärmbelästigung zu groß. Letztendlich wurden lediglich die obere Terrasse und ein kleiner Anbau zum Hang hin genehmigt.Die Aktivitas verbrachte diese Zeit recht sorglos, man lebte nach der Devise „Im Winter studieren, im Sommer Student sein.“
Der Wingolf im kriegerischen Europa
Diese Zeit der Ausgelassenheit endete schlagartig mit dem Beginn des 1. Weltkrieges am 1. August 1914. Die Wingolfiten unterschieden sich in ihrem Verhalten und ihrem Patriotismus nicht von der übrigen Bevölkerung, auch hier rannten junge und ältere Männer mit „Hurra!“-Gebrüll in den Krieg, den sie nur zu bald in seiner ganzen Grausamkeit kennenlernen sollten. Der Heidelberger Wingolf verlor in den Jahren 1914-18 dreißig Mitglieder, 15 Aktive und 15 Alte Herren. Zu ihrem Andenken wurde am Haus ein Gedenkstein angebracht.
Mit den Studenten der beginnenden 20er Jahre lebte der Verbindungsbetrieb wieder auf. Neue Lebensformen prägten den Wingolf. Die Natur spielte eine stärkere Rolle. So wurden viele Ausflüge unternommen. Auch Leibesübungen wurdenstärker betont. Dies umfasste Schwimmen, Leichtathletik und das Fechten zu Übungszwecken. Das 75. Stiftungsfest1926 wurde aufwendig begangen. Ein großer Festzug von fünf Reitern, über 30 Aktiven und 330 Wingolfitenaus dem Bund zog durch die Altstadt.Durch die Weltwirtschaftskrise 1929 wurden in den Folgejahren vermehrt politische und gesellschaftliche Streitpunkte in den Wingolf hineingetragen. Allerdings blieb der Wingolf als solcher auf dem Standpunkt, politisch keine Position zu beziehen. Mit der Machtübernahme derNationalsozialisten am 30. Januar 1933 begannen auch die Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund (NSDStB),der die Alleinvertretung der Studenten für sich beanspruchte. Zunächst wurde vom Wingolf die Einführung des Fechtens gefordert, welches der Wingolf aber weiterhin ablehnte.Weiterhin mussten alle Verbindungen das Führerprinzip einführen,wodurch die basisdemokratischen Entscheidungsgremien (Convente) abgeschafft werden mussten. Zudem wurde die Einführung des Arierparagraphen gefordert.Die anschließenden Debatten im Wingolf, ob man diesem nachkommen sollte, zog viele Austritte empörter Alter Herren nach sich.Als zusätzlich weiterhin auf die Einführung des Fechtens bestanden wurde, sah sich der Heidelberger Wingolf am 5. November 1935 gezwungen, die aktive Verbindung aufzulösen.Der Gedenkstein für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs fand in der Heiliggeistkirche seinen neuen Platz.In den folgenden Jahren kam es weiterhin zu Zusammenkünften von Aktiven und Alten Herren,welche mit Beginn des Zweiten Weltkriegs endeten.
Der Heidelberger Wingolf seit 1948
Der 2. Weltkrieg hatte auch viele Heidelberger Wingolfer das Leben gekostet – vierzig Bundesbrüder waren gefallen. Die Wiedergründung der Verbindung erfolgte am 18. Juni 1948, sein Verbindungshaus in der Werrgasse 4 erhielt sie allerdings erst 1957 wieder zurück. Nach einem kurzen Richtungsstreit einigte man sich in der Aktivitas auf das alte Prinzip „Di henos panta !“ – „Durch einen – Jesus Christus – alles!“.Drei Jahre nach der Wiedergründung feierte der Heidelberger Wingolf sein 100. Stiftungsfest – auf dem Schloß wehte dazu eine riesige blau-weiß-goldene Fahne. Die Aktivitas war bis Ende der sechziger Jahre recht stark, im Jahr 1955 übernahm der Heidelberger Wingolf wieder einmal den Vorsitz im Wingolfsbund.Mit den Studentenunruhen endete diese Zeit recht abrupt; die Aktivmeldungszahlen sanken fast auf Null, und der Wingolf führte bis in die siebziger Jahre nur ein Schattendasein. Erst zu Anfang der achtziger Jahre sollte sich dies ändern.Die damals noch fünf Buden auf dem Haus waren ständig belegt und es kam etwas Glück bei den Aktivmeldungen hinzu, so daß es während der gesamten achtziger Jahre eine große Aktivitas gab.Durch den Zuzug von Bundesbrüdern aus Göttingen, wo man damals Frauen aufnahm, kam es im Heidelberger Wingolf zu einer Diskussion um eine ähnliche Praxis – es wurde zwar Abstand genommen von der Aufnahme weiblicher Mitglieder in den Heidelberger Wingolf, jedoch wurden Frauen fortan zu allen Veranstaltungen eingeladen.Anfang der neunziger Jahre wurden Pläne für einen Ausbau des Erdgeschosses erstellt.

Die Renovierungsarbeiten, die bereits im Herbst 1994 begonnen hatten, wurden erst 1997 mit dem Neubau der Außentreppe abgeschlossen.Im selben Jahr übernahm der Heidelberger Wingolf wieder den Vorsitz im Wingolfsbund, den er für zwei Jahre innehatte. Am Abschluß dieser Zeit stand das 67. Wartburgfest des Wingolfsbundes, welches der Heidelberger Wingolf in gebührendem Rahmen im Mai 1999 ausrichtete.Geschichte des WingolfsbundesAuf der Seite des Wingolfsbundes kann man Details zur Geschichte des Wingolfsbundes nachlesen.